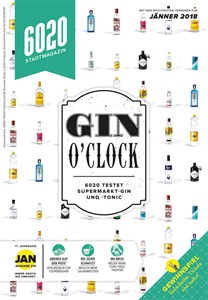s gibt so Sätze, die einen unverstanden zurücklassen, wenn man sie ausspricht. Zum Beispiel: Die eineinhalb Jahre ohne Autoradio zählen zu den schönsten meines Lebens. Zack – und schon ist es passiert. Ich kann förmlich spüren, wie Sie sich verwundert die Augen reiben (aber fragen Sie mich nicht, wie das funktioniert).
//Sie, liebe Freunde der paranormalen Kolumnenrezeption, fragen sich ja wahrscheinlich sowieso etwas anderes. Nämlich: Was hat der Psycho denn jetzt schon wieder gegen Autoradios? Ich frage Sie: Was nützt mir eine Geisterfahrermeldung, wenn ich mir beim anschließenden Song nichts mehr wünsche, als einer zu sein? Was habe ich in welchem Leben auch immer verbrochen, um mich in Ermangelung erträglicher Alternativen freitagabends ins Regionalradio flüchten zu müssen, wo im Optimalfall eine schmalzige Nummer von Elvis Presley gespielt wird oder wenigstens irgendwas von Peter Cornelius, der sich mit dem voll aufgedrehten Lüftungsgebläse ja bekanntermaßen halbwegs entschärfen lässt? Und bin ich der Einzige, den beim Ö1-Programm ab 21 Uhr eine tiefe Todessehnsucht überfällt?
//No Autoradio, No Cry. Ich bekomme immer noch feuchte Augen, wenn ich an diese unbeschwerte, ausgelassene Zeit zurückdenke. Es war wie der Summer of ’69, eben bloß ohne das gleichnamige musi-kalische Kapitalverbrechen. Nur die Fahrgeräusche drangen an meine Ohren und hin und wieder das akkurat vorgetragene Klagen der Ehefrau, die diesem musiklosen Zustand nichts abgewinnen konnte und sich vom debilen Glückseligkeitsgrinsen des Ehemanns provoziert fühlte.
//Es ist ja so, irgendwann erreicht man einfach einen Punkt in seinem Leben, an dem man sagt: Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik. Und man ist dankbar, wenn ein Gerät, das in den falschen Händen so viel Leid anzurichten im Stande ist, einfach hin wird.
Es ist nicht Bedingung, dass der Künstler tot ist, aber es hilft.
Man kennt das ja vom kaputten Karaokeautomaten im Stammlokal, der 1996 auf Grund seines verlässlichen Außerbetriebseins so manches unfreiwillige Bühnendrama verhinderte. Oder auch von Nachbars kaputter Ehe, der man nun verdankt, nicht mehr mitten in der Nacht von hysterischen Lustschreien aus dem Schlaf gerissen zu werden. Ich nenne das die Ästhetik des Defekten, über welche ich im Übrigen noch eine traktatartige Absonderung mittlerer Länge zu Papier zu bringen gedenke. Stoßrichtung: Wann haben wir verlernt, das Kaputte wertzuschätzen?
//Zu meinem Musikgeschmack lässt sich festhalten: Es ist nicht Bedingung, dass der Künstler tot ist, aber es hilft ungemein. Wenn zudem kein genrebedingtes Auf-Eins-und-Drei-Dazuklatschen erfolgt und der Intrepret nicht altklug von Leid und Pein dahersingt, obwohl er in seinem Kleinjungenleben noch nie beim nächtlichen Toilettengang auf einen Legostein getreten ist, also überhaupt keine Vorstellung davon hat, was Schmerz ist, auch sehr fein. Weitere Details muss ich Ihnen schuldig bleiben. Schließlich bin ich ja noch nicht ganz deppert, weshalb ich versuche, unter Anwendung größtmöglicher diplomatischer Ver-renkungen die Maria-Curry-Fans unter Ihnen nicht zu vergraulen. Und auch nicht die Bach-Freunde.
//Obwohl das schwerfällt. Christopher Knight, der 27 Jahre in den Wäldern des US-Bundesstaates Main als Einsiedler unterwegs war und sich aus Hütten und Ferienhäusern klassische Musik für den Walkman zusammenklaute, hörte lieber nichts als Bach, denn: „Bach ist zu makellos.“
//Ich sage: Bach ist nur bei Petzibär und Jacques Loussier erträglich. Aber damit ist auch wieder einmal niemandem geholfen.