KK, das klingt kalt, technokratisch, unpersönlich und bedient alle Vorurteile gegenüber der neuen Galionsfigur für die Verweiblichung von Politik. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer ein viel größeres Kaliber ist, als aus der bisherigen Berichterstattung zu erahnen war, offenbarte sie jedoch bereits bei ihrem ersten TV-Polittalk als CDU-Chefin. Wie sie bei „Anne Will“ ihre überheblichen männlichen Widersacher geradezu vorgeführt hat, das wird noch in einigen Jahren ein YouTube-Lehrstück für politische Kommunikation sein. Unterdessen ist die nächste deutsche Kanzlerin zwar einerseits ein Symbol für „the new normal“, wirkt andererseits aber als Indiz für das ideologische Paradoxon von Frauen in der Politik. In Deutschland bleiben durch die Nachfolgerin von Angela Merkel und SPD-Chefin Andrea Nahles beide Regierungspartner unter Frauenführung.
Doch Mehrheitsfähigkeit mit weiblichem Aushängeschild genießen ausgerechnet jene Mitte-rechts-Parteien, die auch unter Chefinnen nicht unbedingt als Bannerträgerinnen des Feminismus gelten. Schon das Kürzel „Mutti“ für „Merkel“ zeigt, dass die Wählerschaft insgesamt noch eher die Geborgenheit des Matriarchats sucht. Gruppierungen mit einer traditionellen bis pragmatischen Rollensicht sind also strategisch im Vorteil. Die CDU wirkt global als Musterfall für langsame, beharrliche Gender-Transformation.
//Einem derartigen Fremdbild entsprechen die britischen Konservativen trotz des feministischen Selbstbekenntnisses ihrer Chefin Theresa May kaum. So wie die Ministerpräsidentin den Eiserne-Lady-Status ihrer Vorgängerin Margaret Thatcher erbt, so erscheint sie auch als Ausnahme einer männlichen Tory-Regel. Die US-Demokraten hingegen sind die Partei der Frauen und Minderheiten. Sie überfordern damit aber die immer noch relativ größte Wählergruppe der weißen Männer.
Die Feminismus-Falle.
Diese strategische Falle droht aktuell in Österreich auch der SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Die Sozialdemokraten verlieren hier seit vielen Jahren Arbeiterschaft und junge Männer an die FPÖ. Nun stehen die GenossInnen vor einer Zerreißprobe, entweder diesen Gruppen neue Angebote zu bieten oder eher der Bildungselite und den Frauen, die sonst stärker zu den Grünen tendieren.
//Aus dieser Perspektive ist der Fall Georg Dornauer mehr als nur die Überdimensionierung einer Mücke zum Elefanten im Porzellanladen der Gender-Befindlichkeiten. Die von der ÖVP via Social Media losgetretene Empörungswelle wirkt prototypisch für die Sprengkraft des Widerstreits in der SPÖ. Dabei gilt es nicht nur zu hinterfragen, wie sexistisch ein flapsiger Sager des Tiroler Parteichef wirklich einzuordnen ist. Mehr noch geht es darum, warum Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek umgehend seinen Rücktritt fordert und Rendi-Wagner ihn prompt aus den Bundesgremien verbannt.
Die CDU wirkt global als Musterfall für langsame, beharrliche Gender-Transformation.
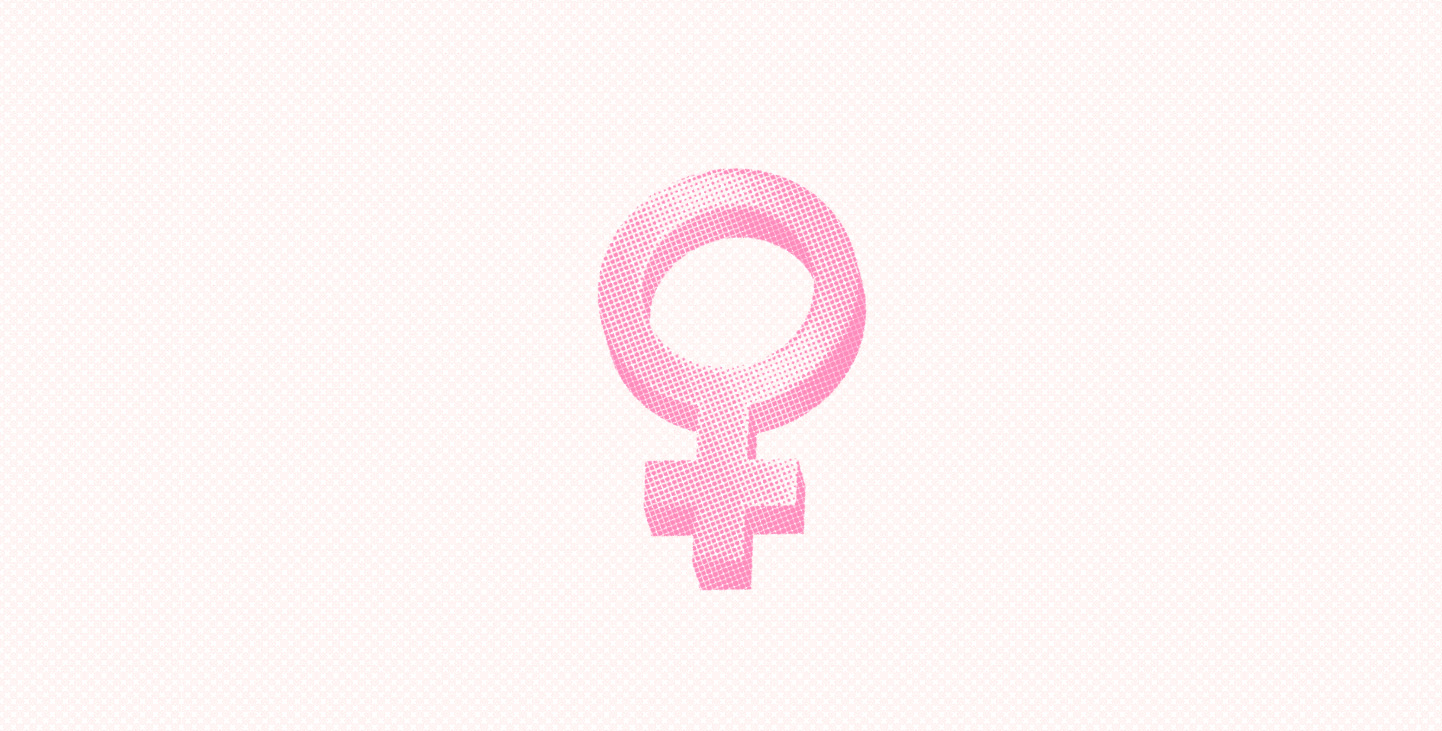
Wer eine Antwort darauf mit weniger frauenfreundlichen Scheuklappen sucht, als es heute opportun ist, darf die Möglichkeit eines puren Machtspiels nicht außer Acht lassen: Dornauer war bis zu diesem Zeitpunkt ein roter Hoffnungsträger in der sozialdemokratischen Diaspora – als Querverbinder von Stadt und Land, Jung und Alt, Eliten und Bodenständigen; gesprächsfähig von links nach rechts. Wenn so einer wegen einer vergleichsweise lässlichen Rhetorik-Sünde zum Bauernopfer wird, gewinnen die Feministinnen zwar ein internes Match, doch sie schmälern die Wählerzielgruppen der SPÖ. Solch kurzfristige Taktik statt langfristiger Strategie behindert statt beschleunigt die Auferstehung zu einer Volkspartei. Das zeigt sich ausgerechnet an Dornauers Heimatfront besonders deutlich. Denn das grundsätzlich konservative Tirol belegt prototypisch, dass die Verweiblichung der Politik durch Frauen in Spitzenpositionen nicht zwangsläufig mit Feminismus einhergeht. Die dennoch gesellschaftsverändernde Wirkung durch solche Postenbesetzungen vollzieht sich eher nach dem Prinzip „steter Tropfen höhlt den Stein“.
Das gilt vorerst für die Wahlchancen von Parteien mit Spitzenkandidatinnen und bei Erfolg auch für ihre Politik. Offensiver Feminismus wirkt immer noch nicht mehrheitsfähig außerhalb der wirklich urbanen Räume – vielleicht nicht einmal dort.
Pragmatischer Gender-Zugang.
Tirol und Innsbruck hingegen sind schwarzgrüne Beispiele im Kleinen für das, wofür die CDU in Deutschland steht. Das begann mit der ersten grünen Landesrätin Eva Lichtenberger noch im Proporzsystem und ging weiter mit Hilde Zach als erster Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt. Das setzte sich fort mit Christine Oppitz-Plörer als ihrer Nachfolgerin und zeigt sich heute an einer aus je vier Männern und Frauen bestehenden Landesregierung sowie einem Stadtsenat mit weiblicher Mehrheit. 18 von 40 Gemeinderätinnen verdeutlichen im Vergleich zu lediglich 12 von 36 weiblichen Landtagsabgeordneten aber auch das Stadt-Land-Gefälle in der Gender-Frage.
Nun erscheint es einerseits folgerichtig, sich genau mit diesem Thema gegen die einzige Partei zu positionieren, die noch nie eine Frau an ihrer Bundesspitze hatte, obwohl auch die erste Ministerin Grete Rehor und die erste Landeshauptfrau bzw. „Frau Landeshauptmann“ Waltraud Klasnic aus der ÖVP stammten. Dafür spricht andererseits, dass neben der SPÖ auch Neos und Jetzt durch Beate Meinl-Reisinger und Maria Stern weiblich geführt werden – also alle Oppositionsparteien. Diese Entwicklung ist insgesamt gut und überfällig. Sie wird sich von der Bundes- über alle Landes- bis zu den Gemeindeebenen rasant fortsetzen. Das birgt aber auch Gefahren für jene Gruppierungen, die den inneren Umbruch zu wenig behutsam für ihre Außenwirkung gestalten. Mehrheitsfähigkeit entsteht eher aus kalkulierter Zurückhaltung und pragmatischem Zugang zum Geschlechterthema. Diese Einschätzung entspringt keiner Überzeugung, ob das richtig oder falsch ist, sondern den Erfahrungen mit Wahlen. Sie fördern eher die feminine Erosion als eine feministische Revolution.


