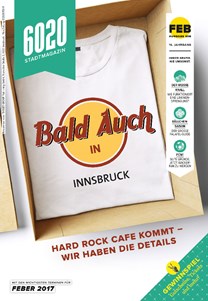Die Geschichte
Nachdem sie ab 2005 die ersten Clubabende veranstaltet hatten, übernahmen Andy Franzelin und Justin Barwick im Sommer 2006 das ehemalige Nutopia und gaben den Räumlichkeiten in der Tschamlerstraße den Namen Weekender Club & Café.

„Ich vermisse eine klare Positionierung der Stadt: Will man nun eine Weltstadt sein mit gelebter Jugendkultur oder nicht?“

Was ist passiert, seit ihr die Schließung des Weekenders publik gemacht habt? Andy Franzelin: Das waren sehr turbulente Tage, das Feedback war enorm. Natürlich haben wir mit Reaktionen gerechnet, aber dass es keine halbe Stunde dauert, bis sich fünf verschiedene Medien melden, war dann doch überraschend. Unser Post hat laut Facebook 200.000 Menschen erreicht. Im Nachhinein bekommt man dann schon das Gefühl, dass man etwas mit Bedeutung geschaffen hat. Dieses Gefühl hatten wir über die letzten Jahre nicht immer, zum Beispiel, wenn zu einem Konzert nur 13 Leute gekommen sind.
Wann ist die Entscheidung endgültig gefallen? Zugespitzt hat es sich im letzten halben Jahr. Die Entscheidung ist erst am Dienstag der Woche gefallen, in der wir das Ende publik gemacht haben. Wir haben uns bewusst die Zeit über Weihnachten genommen, um die Situation zu überdenken. Als wir uns dann wieder zusammengesetzt haben, kam genau an diesem Tag der Brief von der Stadt mit den verschärften Auflagen für zukünftige Konzerte. Das war zu viel. Noch mehr Prügel können und wollen wir nicht einstecken. Jetzt muss es relativ schnell gehen – wir veranstalten bis Ende Mai noch alle vertraglich vereinbarten Konzerte, aber wir können keine neuen Bookings mehr annehmen. Das schnelle Ende überrascht auch uns, aber wir sehen keinen Ausweg aus der Situation.
Hätte der Weekender ohne die Anrainerbeschwerden so weitermachen können wie bisher? Selbst wenn man diese Problematik ausklammert, hätten wir etwas an unserem Geschäftsmodell ändern müssen. Und diese Änderungen hätten mit Lärmemissionen zu tun. Also ist das eine ganz schwierige „Was wäre, wenn“-Frage. Aber wir sagen es ganz offen und ehrlich: Es sind nicht nur die Nachbarn.
Es gibt andere Schwierigkeiten, die vielleicht auch zum gleichen Ergebnis geführt hätten, aber wir hätten sicher noch einiges probiert.
2015 hast du im 6020-Interview gesagt: „Innsbruck ist ein fantastischer Ort, um Konzerte zu veranstalten.“ Bist du immer noch dieser Meinung? Ich habe in den letzten Tagen selbst an diesen Satz zurückgedacht. Wenn man an die Vergnügungssteuer denkt, dann erscheint dieses Zitat von damals tatsächlich als Widerspruch zu dem, was ich jetzt sage. Aber trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass Innsbruck ein fantastischer Ort für Konzerte ist. Der Grund dafür ist die Begeisterung des Publikums – jeder Auftritt einer größeren Band sorgt hier immer noch für Aufregung. In Wien passiert so etwas einfach nicht. Die bürokratischen Eigenheiten machen Innsbruck trotzdem zu einem veranstaltungsfeindlichen Pflaster. Die Tatsache, dass man 75.000 Euro an die Stadt überweist und gleichzeitig weiß, dass man diese Summe in einer anderen Gemeinde für sinnvollere Dinge verwenden könnte – zum Beispiel die Verbesserung der Anrainerproblematik –, schmerzt schon. Die MÜG hat uns ganz offen gesagt, dass Anrainerbeschwerden jetzt generell ernster genommen werden, das verschärft die Situation für Veranstalter natürlich weiter. Da vermisse ich schon eine klare Positionierung der Stadt: Will man nun eine Weltstadt sein, ein urbaner Raum mit gelebter Jugendkultur? Dann sollte man auch mit den Nebenerscheinungen dieser Belebung leben.
Fühlst du dich in der derzeitigen Rolle des Kämpfers und Kritikers eigentlich wohl? Wenn die Causa Weekender dazu führt, dass die Vergnügungssteuer abgeschafft wird, dann hätten wir zumindest etwas hinterlassen – das würde mich schon sehr freuen. Aber ich habe mir diese Rolle nicht ausgesucht, ich würde lieber nicht über diese Themen reden müssen. Gerade in der Anrainerthematik aber hätte ich mir schon Support von Seiten der Stadt erwartet.
Nach zehn Jahren wie ein Krimineller behandelt zu werden, muss ich mir eigentlich nicht mehr geben. Nichtsdestotrotz: Es liegt uns fern, nur den anderen die Schuld zu geben. Vielleicht haben wir uns auch einfach zu ungeschickt angestellt. So selbstkritisch muss man sein.
Glaubst du mittlerweile, dass jeder Club ein Ablaufdatum hat? Ja, irgendwie schon. Man kann natürlich versuchen, sich neu zu erfinden, das haben wir auch versucht. Unsere Überzeugung war immer, dass wir mit dem Veranstalten von Konzerten ein gewisses zeitloses Element haben. Bands sterben aus, neue kommen nach, auch lokale Acts, da kann man sich in gewisser Weise immer wieder selbst „verjüngen“. Aber rein vom Zyklischen gesehen glaube ich schon, dass jeder Club seine Zeit hat. Nach elf Jahren ist es jetzt bei uns so weit. Aber, um es mit Neil Young zu sagen: It’s better to burn out than to fade away.
Und glaubst du mittlerweile auch, dass der Job des Clubbetreibers ein Ablaufdatum hat? Schwierige Frage. Was das Alter betrifft, ja. Als wir aufgesperrt haben, war ich quasi gleich alt wie unsere Kernzielgruppe. Natürlich spricht man da eine Sprache und weiß, was gefragt ist. Dementsprechend tut man sich eben etwas schwerer, wenn man nicht mehr so alt wie die Zielgruppe ist. Wir haben uns aber in letzter Zeit auch immer öfter die Frage gestellt, ob das „Konzept Club“ an einem fixen Ort, mit fixer Einrichtung und fixen Kosten überhaupt noch Bestand hat oder ob gerade etwas anderes gefragt ist, Stichwort Pop-up-Events. Momentan ist alles sehr beweglich, die Leute wollen ständig etwas Neues. Wenn man heute eine monatliche Veranstaltung macht, dann flaut das Interesse bereits nach ein paar Monaten ab. Das war früher nicht so.
„Zwischen einem traurigen Smiley und einem Ticketkauf ist eben doch ein Unterschied.“
Meinst du diese Entwicklung, wenn du in eurem offiziellen Statement schreibst, dass sich die Club- und Eventkultur verändert hat? Ja, unter anderem. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass das sogenannte Vorglühen noch viel wichtiger wird. Das sehen wir alleine an den Flaschen und Dosen, die bei uns vor dem Eingang liegen. Die Leute gehen außerdem noch später in die Clubs. Es gibt interessante Cafés, es gibt generell mehr ansprechende Gastronomie. Das ist eine positive Entwicklung, aber sie verändert das Ausgehverhalten. Und wenn eine Stadt so beweglich ist wie Innsbruck, wieso soll ich dann wirklich jeden Freitag in dasselbe Beisl oder den selben Club gehen? Vielleicht haben wir im Moment in Innsbruck sogar ein Überangebot. Und es ist nun mal so, dass man in einer Stadt dieser Größe sofort spürt, wenn ein großes Event ist und die Leute an diesem Tag in den anderen Lokalen „fehlen“.
Hast du dir angesichts der Sympathiebekundungen der letzten Tage auf Facebook manchmal gedacht: Lieber wäre mir gewesen, ihr wärt öfter zu den Konzerten gekommen? Natürlich ist diese Wertschätzung toll, das schmeichelt und macht auch stolz. Aber man denkt sich durchaus: Wenn nur jeder Hundertste ein paar Tickets mehr gekauft hätte, hätte es ein paar schlecht besuchte Konzerte nicht gegeben. Zwischen einem traurigen Smiley und einem Ticketkauf ist eben doch ein Unterschied. Aber wenn die Besucher ausbleiben, muss man immer die Gründe zuerst bei sich selbst suchen, alles andere wäre zu einfach.
Kann man daraus trotzdem die Botschaft ableiten: Support your local venue? Auf jeden Fall. Ich persönlich bin ein sehr loyaler Mensch und denke: Wenn man etwas gut findet, dann muss man es unterstützen, hingehen, konsumieren. Das ist die Entscheidung eines jeden Gastes. Aber das sagt sich vermutlich leichter, wenn man 37 ist und nicht jeden Cent umdrehen muss.
Gibt es vielleicht einfach nicht genug musikinteressiertes Publikum in Innsbruck? Sagen wir mal so: Heutzutage muss man nicht mehr wegen der Musik ausgehen. Eine YouTube-Playlist ist schnell gefunden. Um nur von Musikliebhabern zu leben, ist die Stadt wirklich zu klein. Wir haben über die Jahre versucht, die Balance zu schaffen: Wir haben Veranstaltungen gemacht, die nicht unbedingt anspruchsvoll waren, aber beim Publikum nun mal ankommen. Das haben uns einige vorgeworfen. Aber wir mussten schauen, dass wir wirtschaftlich überleben, damit wir die Herzblutgeschichten, die eher Geld kosten als bringen, machen können. Wenn jemand sagt, wir sind deshalb ein Kommerzladen, kann ich super damit leben. Einen Club, der sich nur an Musikliebhaber richtet, hätten wir wohl nach eineinhalb Jahren zugesperren müssen. Und nur so nebenbei: Alle Konzerte, von denen ich richtig begeistert war, waren wirtschaftlich kein Erfolg.
„Einen Club, der sich nur an Musikliebhaber richtet, hätten wir wohl nach eineinhalb Jahren zugesperren müssen.“
Wie geht es für dich weiter? Keine Ahnung. Nachdem das alles so schnell gegangen ist, muss ich erst mal das emotionale Chaos verdauen und dann herausfinden, was mir Spaß macht und was nicht. Aber es ist kein Geheimnis: Das, was ich am liebsten mache, ist Musik unter Leute zu bringen. Wir sind als Weekender-Team mittlerweile sehr erfahren darin, Events zu planen und durchzuführen, da stellt sich die Frage, ob wir das auch weiterhin machen. Ohne fixe Venue ist das natürlich ungleich schwieriger. Vielleicht findet man einen Weg, um weiterhin Bands und Acts nach Innsbruck zu holen.
Habt ihr euch schon überlegt, wie die letzte Party aussehen wird? Es gibt diverse Überlegungen, aber noch ist nichts fix. Wenn es nach mir geht, sollte es keine reine Hommage an die Anfangszeit sein. Zu sehr vergangenen Trends nachzutrauern, finde ich falsch.
Und welcher Song soll als letztes gespielt werden? Auch da entziehe ich mich ein bisschen dem Pathos. Vielleicht drehen wir einfach nach einem Lied ab und das war’s dann. Wenn ich mir etwas aussuchen müsste, dann wäre es wohl „Hey Hey, My My“ von Neil Young.
Vielen Dank für das Gespräch.